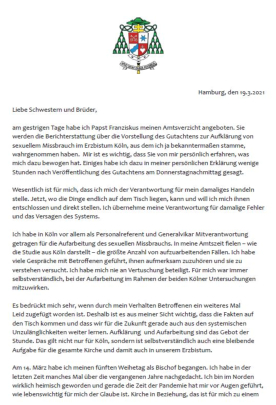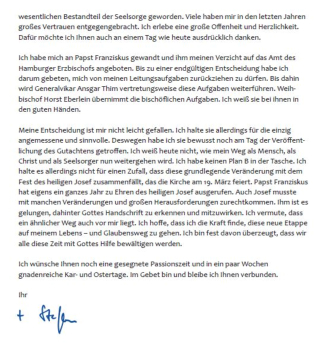:: Startseite
............................................
:: Historie
............................................
:: Unsere Kirche
............................................
:: Hl. Agnes
............................................
:: Sakramentenspendung
............................................
:: Gemeindeleben
............................................
:: Kontakt / Impressum
............................................
:: St. Martin Barsbüttel
............................................
:: Erzbistum Hamburg
............................................
:: SKFvorOrt©
...........................................
:: Pastoraler Raum
Copyright Dezember 2010 katholische Kirchengemeinde St. Agnes - Tonndorf


Gezeichnet: G. Jakubik
SPRUCH DES MONATS
........................................
Die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben ist.
Halleluja. Röm 5,5
.......................................
DOWNLOADBEREICH
> Vermeldungen
> Pastoraler Raum
> Gottesdienstordnung
> Messdiener
> Lektoren
> Kommunionhelfer
> Aktuelles
> Firmkurs
> Pfarrbrief

Brief des Erzbischofs!
Liebe Schwestern und Brüder!
An zwei Sonntagen im Jahr kann die liturgische Farbe rosa sein; das Violett der Bußzeiten
in der Fasten- und Adventszeit wird bereits im Sinne der Vorfreude durch die weiße Farbe
himmlischer Vollendungsfreude am vierten Fastensonntag („Laetare!“ – „Freu Dich!“) und
am dritten Adventssonntag („Gaudete!“ – „Freut Euch!“) etwas lichter und heller – eben
rosafarben. Gegen Schluss des Hochamts am vergangenen Laetaresonntag überreichte
ich unserem Erzbischof Stefan Heße zum Dank und anlässlich seines sechsten
Bischofsweihetages eine golden verzierte Rose; denn eine Goldene Rose wird als
Auszeichnung des Papstes an Personen, Staaten oder Wallfahrtsstätten verliehen, die
sich um die katholische Kirche besonders verdient gemacht haben. Diese päpstliche
Auszeichnung besteht freilich aus vergoldetem Silber. Die Rose steht dabei für Jesus
Christus, wobei die Dornen seinen Leidensweg symbolisieren und das Gold seine
Auferstehung – so kam der vierte Fastensonntag unmittelbar vor der Passionszeit zu
seiner besonderen Farbe. Dem Laetaresonntag entsprechend, trug der Erzbischof ein
rosa Messgewand – mein eigenes Primizgewand -, das die Vorfreude auf Ostern
symbolisiert.
Einen „wetterfesten Glauben“ wünschte Erzbischof Stefan Heße in seiner Predigt der
neuen Pfarrei „Sankt Paulus – Apostel der Völker“. Unsere neue Pfarrei mit mehr als
20.000 Katholiken war nach fünf Jahren Vorbereitungszeit, in die auch die bitteren
Schulschließungen und die Immobilienreformen fielen, mitten in der seit exakt einem Jahr
grassierenden Pandemie zu Beginn des Pontifikalamts in unserer Billstedter Kirche St.
Paulus feierlich gegründet und ich zu ihrem Pfarrer ernannt worden. Sie umfasst neben
St. Paulus auch die ehemaligen altehrwürdigen Pfarreien St. Joseph in Wandsbek und St.
Agnes in Tonndorf. Der 14. März war zugleich der sechste Weihetag Heßes, der im März
2015 sein derzeitiges Bischofsamt antrat.
Mit „wetterfest“ meinte der Erzbischof einen Glauben, der auch in Krisen gelebt wird.
Krisen seien etwas Normales; jeder mache sie durch, auch ein Bischof. Und die Bibel sei
geradezu ein Buch der Krisen. Es komme darauf an, diese anzunehmen. In diesem
Zusammenhang verwies er auch auf die Krise, die die Gesellschaft aufgrund der Corona-
Pandemie durchmache, sowie auf die „dicke Krise“, in der sich die katholische Kirche
momentan befinde. Es werde auch nicht so sein, dass wir die Krise erst einmal lösten,
und dann gehe es einfach so weiter, führte der Erzbischof aus. Die Kirchen und
kirchlichen Einrichtungen wie Pfarrsäle, Schulen oder Kitas bezeichnete Heße überdies
als Schutzräume, die von Menschen in Krisen aufgesucht werden könnten. Er sei deshalb
froh, dass die Kirchen tagsüber auch weiter zum Gebet geöffnet seien.
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hatte eine Videobotschaft an die neue
Pfarrei gerichtet. Tschentscher dankte den nun zusammengeschlossenen Pfarreien
darin, dass sie sich so „engagiert und im christlichen Sinne für das Gemeinwohl in
Hamburg einsetzen“.
Niemand ahnte, dass dies das letzte Pontifikalamt unseres Erzbischofs sein würde; nur
vier Tage später bot er nach Veröffentlichung des Kölner Gutachtens dem Papst seinen
Amtsverzicht an und schrieb uns: „Ich habe mich an Papst Franziskus gewandt und ihm
meinen Verzicht auf das Amt des Hamburger Erzbischofs angeboten. Bis zu einer
endgültigen Entscheidung habe ich darum gebeten, mich von meinen Leitungsaufgaben
zurückziehen zu dürfen. Bis dahin wird Generalvikar Ansgar Thim vertretungsweise diese
Aufgaben weiterführen. Weihbischof Horst Eberlein übernimmt die bischöflichen
Aufgaben. Ich weiß sie bei ihnen in den guten Händen.
Meine Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich halte sie allerdings für die einzig
angemessene und sinnvolle. Deswegen habe ich sie bewusst noch am Tag der
Veröffentlichung des Gutachtens getroffen. Ich weiß heute nicht, wie mein Weg als
Mensch, als Christ und als Seelsorger nun weitergehen wird. Ich habe keinen Plan B in
der Tasche.“
Dass ich nach zwei Rücktritten von Bundespräsidenten und einem Papstrücktritt nun auch
noch einen Rücktritt des eigenen Metropolitanerzbischofs erleben würde, kam mir nie in
den Sinn. Die in der letzten Bischofspredigt angesprochenen Krisen überlagern sich ja
massiv: Pandemie; in Hamburg steigende Inzidenzwerte und ein zweites Ostern mit
massiven Einschränkungen und Existenzängsten; in unserer Pfarrei im Hamburger Osten
mit über 100 Nationen und manchen Brennpunktvierteln herbe psycho-somatisch-soziale
Belastungen; eine mit sich selbst beschäftigte Kirche inmitten der Aufarbeitung von
Machtmissbrauch; ein Erzbistum Hamburg ohne Priesterweihen, aber mit erheblichen
Finanznöten; ein Superwahljahr, das mit der Aufdeckung sich bereichernder
Unionspolitiker begonnen hat. Kurzum: Vertrauensverlust.
Der um Amtsverzicht bittende Hamburger Erzbischof hat als letzte Pfarrei unsere Pfarrei
gegründet: „Sankt Paulus, Apostel der Völker“. In dieser neuen Pfarrei leben Katholiken
aus mehr als 100 Nationen. Unter den Nicht-Deutschen sind am stärksten Polen,
Vietnamesen, Kroaten, Portugiesen, Italiener, Spanier und Ghanaer vertreten. Diese
Vielfalt kommt auch in dem Namen der Pfarrei zum Ausdruck, genauer: dem Zusatz
„Apostel der Völker“ – als solchen bezeichnete sich Paulus selbst. Gern pflege ich den
Brauch, in jeder Klasse der St.- Paulus- Schule eine Weltkarte aufzuhängen, um in all die
Länder eine bunte Stecknadel zu stechen, in die hinein wir durch die Stammbäume der
Schulkinder Beziehungen haben. Wenn in jedem Land eine Nadel steckt, wird die ganze
Welt unser schulisches Zuhause sein. In der Kirche gibt es keine Ausländer. Gottes Geist
vereint uns mit den unterschiedlichsten Charismen eines jeden Geschöpfes zu einer
Weltenfamilie.
Mein jesuitischer Lehrer für Paulus war Norbert Baumert. „Paulus neu gelesen“ – mit
dieser Reihe legte Norbert Baumert seine in über 45 Jahren erarbeitete, veränderte Sicht
der Paulusbriefe in einer Gesamtschau vor „Weg des Trauens“ – dieser Titel fasst
programmatisch den Inhalt paulinischen Denkens zusammen: Gott kommt in Christus
dem Menschen mit „Trauen“ entgegen und lockt ihn auf diese charismatische Weise, auch
ihm zu „trauen“. Dieses gegenseitige „Trauen“ ist als Übersetzung des griechischen
Urtextes umfassender und personaler als das eher sachhafte ‚Glauben’ (wie man das
griechische pístis gewöhnlich übersetzt) und wird zuallererst von Gott ausgesagt. Die
Briefe des Völkerapostels entwickeln dieses ‚Prinzip Trauen’ im Rahmen von
Auseinandersetzungen, wobei offensichtlich gerade die ‚Ungeschütztheit’ dieses Trauens
neubekehrte Heidenchristen davon abhält, sich auf diese Weise mit Haut und Haar auf
Gott einzulassen: sie sind ‚miss-trauisch’, und einige versuchen, sich in einer hermetisch
abgeriegelten Panzermentalität – die übrigens zu Ängsten, Verschwörungstheorien und
Nationalismen führt (!) – ein dubioses und esoterisches frommes System zurechtzulegen.
Dies bedeutet auch, dass die „Misstrauenden“ vor dem täglichen Sterben und Auferstehen
mit Christus ausweichen (s. 1 und 2 Kor) und sich somit letztlich der bedingungslosen
Liebe Gottes nicht anvertrauen.
Ein Pauluspatronat will den Weg des Trauens gehen. Widerfahrnisse vieler zeitgleicher
Krisen des Misstrauens erschüttern uns bis ins Mark. Wem können wir noch trauen? Da
fügt es sich, dass wir mit dem Gott, dem Paulus traute, hinübergehen vom Ölberg zum
Kreuz hinein in den Garten der Auferstehung: Dir, Gott, trauen wir, weil Du uns traust.
Gesegnete Passionszeit wünscht von Herzen
Euer Felix Evers.